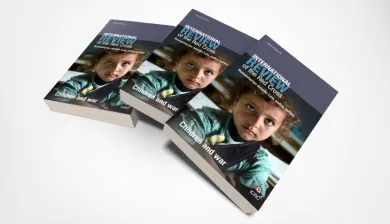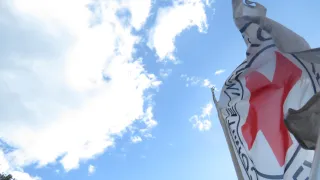Inhaftierung und das Völkerrecht
Das Dritte Genfer Abkommen bietet Kriegsgefangenen weitreichenden Schutz. Es legt ihre Rechte fest und schreibt detaillierte Regeln für ihre Behandlung und ihre spätere Freilassung vor. Das humanitäre Völkerrecht (HVR) schützt aber auch andere Personen, denen in der Folge eines bewaffneten Konflikts die Freiheit entzogen wurde.
Für den Schutz von Kriegsgefangenen gelten spezifische Vorschriften, die erstmals im Genfer Abkommen von 1929 festgeschrieben wurden. Im Dritten Genfer Abkommen wurden sie nach den Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg präzisiert und später durch das Erste Zusatzprotokoll ergänzt.
Der Kriegsgefangenenstatus gilt nur in internationalen bewaffneten Konflikten. Kriegsgefangene sind normalerweise Angehörige von bewaffneten Kräften einer am Konflikt beteiligten Partei, die in die Hände der gegnerischen Seite gefallen sind. Das Dritte Genfer Abkommen legt aber auch andere Kategorien von Personen fest, die Anrecht auf den Kriegsgefangenenstatus haben oder als Kriegsgefangene behandelt werden können.
Kriegsgefangene dürfen nicht dafür belangt werden, dass sie sich direkt an den Feindseligkeiten beteiligt haben. Ihre Inhaftierung ist keine Form der Bestrafung. Sie dient ausschliesslich dazu, ihre weitere Beteiligung am Konflikt zu verhindern. Nach Beendigung der Feindseligkeiten müssen die Kriegsgefangenen unverzüglich freigelassen und heimgeschafft werden. Die Gewahrsamsmacht darf sie wegen möglicher Kriegsverbrechen gerichtlich verfolgen, aber nicht wegen Gewalthandlungen, die gemäss dem HVR rechtmässig sind.
Kriegsgefangene sind unter allen Umständen mit Menschlichkeit zu behandeln. Sie sind vor jeglicher Gewalt sowie vor Einschüchterung, Beleidigungen und öffentlicher Neugierde zu schützen. Das humanitäre Völkerrecht nennt ausserdem Mindestbedingungen für die Haft, unter anderem hinsichtlich Unterkunft, Nahrung, Kleidung, Hygiene und medizinischer Versorgung.
Das Vierte Genfer Abkommen und das Erste Zusatzprotokoll bieten einen umfassenden Schutz für zivile Internierte während internationalen bewaffneten Konflikten. Wenn zwingende Sicherheitsgründe es erfordern, darf eine Konfliktpartei Zivilpersonen internieren oder ihnen einen Zwangsaufenthalt zuweisen. Eine Internierung ist daher eine Sicherheitsmassnahme und darf nicht als Bestrafung eingesetzt werden. Das bedeutet, dass alle internierten Personen freigelassen werden müssen, sobald die Gründe, die ihre Internierung notwendig machten, nicht mehr existieren.
Die Vorschriften für die Behandlung und die Gewahrsamsbedingungen von internierten Zivilpersonen gemäss dem HVR ähneln denjenigen für Kriegsgefangene.
In nicht-internationalen bewaffneten Konflikten sieht der allen Genfer Abkommen und dem Zweiten Zusatzprotokoll gemeinsame Artikel 3 vor, dass Personen, denen aus Gründen im Zusammenhang mit dem Konflikt die Freiheit entzogen wurde, ebenfalls unter allen Umständen mit Menschlichkeit zu behandeln sind. Sie sind insbesondere vor Ermordung, Folter sowie grausamer, entwürdigender und erniedrigender Behandlung zu schützen. Personen, die aufgrund ihrer Beteiligung an den Feindseligkeiten gefangen genommen wurden, sind nicht vor strafrechtlicher Verfolgung gemäss dem geltenden nationalen Recht für diese Beteiligung geschützt.
Aus der International Review of the Red Cross zum Thema Inhaftierung
- Die Pflicht, in gerichtlicher Verfolgung und disziplinarischen Massnahmen gegen Kriegsgefangene „Nachsicht“ walten zu lassen, im Lichte des aktualisierten IKRK-Kommentars zum Dritten Genfer Abkommen
- Ein neues Verständnis von Behinderung im humanitären Völkerrecht: Neuauslegung von Artikel 30 des Dritten Genfer Abkommens
- Das HVR einhalten und für seine Einhaltung sorgen: Interview mit Vertretern des französischen Ministeriums für die Streitkräfte und des Ministeriums für Europa und auswärtige Angelegenheiten
- Zu Gefangenen, Familienleben und kollektiver Bestrafung: der Fall Namnam
- Gegenstände von Gefangenen: die Sammlung des Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondmuseums